Das dokumentarische Theater ist eine besondere Form des Theaters, die sich nicht auf erfundene Geschichten stützt, sondern auf wahren Ereignisse basiert, auf Berichten und Dokumenten der Geschichte und/oder Gegenwart. Es will die Welt so zeigen, wie sie ist – oder vielleicht auch, wie sie sein könnte. Das ist bei anderen Theaterformen auch so, doch hier ist der Bezug unmittelbarer, direkt entlehnt. Dabei verschwimmen nicht selten die Grenzen zwischen Kunst und Wirklichkeit. Doch was genau macht das dokumentarische Theater aus? Welche Formen und Methoden gibt es? Und wie kann es uns helfen, gesellschaftliche Themen intensiver zu erleben und zu verstehen? Lest weiter …
Was ist dokumentarisches Theater?
Das dokumentarische Theater nutzt authentische Quellen – wie Interviews, Gerichtsprotokolle, Zeitungsartikel oder Tagebücher – und bringt sie auf die Bühne. Es will Realität abbilden und dabei oft Missstände, politische Konflikte oder historische Ereignisse kritisch hinterfragen.
Zentrale Merkmale:
- Basierend auf realen Ereignissen
- Verwendung von Originalquellen
- Politisch oder gesellschaftlich engagiert
- Oft an der Grenze zwischen Theater, Journalismus und Geschichtsaufarbeitung
Es kann verschiedene Wirkungsweisen haben: Mal will es aufklären, mal empören, andere Sichtweisen eröffnen, mal einfach zum Nachdenken anregen.
Protagonisten des dokumentarischen Theaters
Einige der wichtigsten Theatermacher:innen, die dokumentarisches Theater geprägt haben, sind:
Peter Weiss (Die Ermittlung, 1965) – basierend auf den Auschwitz-Prozessen, ein Meilenstein des politischen Theaters.
Bertolt Brecht (Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, 1941) – wenn auch nicht klassisch dokumentarisch, nutzt Brecht historische Bezüge als dramatisches Mittel
Anna Deavere Smith (Fires in the Mirror, 1992) – bringt Originalzitate von Interviewpartner:innen auf die Bühne.
Rimini Protokoll (zeitgenössisches Kollektiv) – inszeniert dokumentarische Stücke mit „Experten des Alltags“.
Hans-Werner Kroesinger – einer der führenden deutschen Regisseure für dokumentarisches Theater. Seine Arbeiten, etwa Stolpersteine Staatstheater (2016), setzen sich kritisch mit politischen und historischen Themen auseinander, oft auf der Basis von Archivmaterial und Zeitzeugenberichten.
Anhand dieser Künstler:innen kann man bereits sehen, dass dokumentarisches Theater kein einheitliches Konzept ist – es gibt viele Wege, mit realen Stoffen umzugehen. Wir schauen sie uns im Folgenden mal etwas genauer an.
Formen des dokumentarischen Theaters
Wortgetreues Dokumentartheater
Hier werden Originaltexte, zum Beispiel Gerichtsprotokolle oder Interviews, direkt auf der Bühne gelesen oder nachgespielt.
👉 Beispiel: Die Ermittlung von Peter Weiss – eine Collage aus Aussagen von Überlebenden und Tätern der Auschwitz-Prozesse.
Interview- oder Zeugenbasiertes Theater
Theatermacher:innen interviewen Menschen und bringen deren Berichte – oft wörtlich – auf die Bühne.
👉 Beispiel: Fires in the Mirror von Anna Deavere Smith – ein Stück über ethnische Konflikte in Brooklyn, bei dem Smith alle Rollen selbst spielt und die Stimmen der Interviewten imitiert.
Dokumentartheater mit fiktionalen Elementen
Hier werden echte Dokumente mit erfundenen Szenen oder Figuren kombiniert, um bestimmte Themen künstlerisch zu verdichten.
👉 Beispiel: Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui von Bertolt Brecht – eine Parabel auf Hitlers Machtergreifung, die historische Fakten mit fiktiven Elementen verknüpft.
Reenactment (Nachstellen historischer Ereignisse)
Reale Ereignisse werden genau nachgestellt – oft mit originalgetreuen Kostümen, Kulissen oder sogar echten Beteiligten.
👉 Beispiel: Rimini Protokoll – nutzt oft reale Menschen („Experten des Alltags“) auf der Bühne, die ihre eigenen Geschichten erzählen.
Methoden – Wie wird dokumentarisches Theater gemacht?
🎤 Recherche & Interviews
Viele dokumentarische Stücke basieren auf intensiver Recherche: Theatermacher:innen führen Interviews mit Zeitzeug:innen, werten Zeitungsartikel aus oder sichten Akten.
✍️ Textmontage
Ein wichtiges Stilmittel ist die Montage verschiedener Quellen. Unterschiedliche Perspektiven werden zusammengefügt, um ein Thema aus mehreren Blickwinkeln zu zeigen.
🎭 Verfremdung & direkte Ansprache
Oft werden Brechts Prinzipien genutzt: Durch Verfremdung und direkte Ansprache des Publikums soll eine kritische Reflexion angeregt werden.
📹 Multimediale Elemente
Moderne Inszenierungen arbeiten oft mit Videoaufnahmen, Projektionen oder Audiodokumenten, um die Authentizität zu erhöhen.
Wirkungsabsichten – Warum dokumentarisches Theater?
Aufklärung – Es macht Missstände sichtbar und informiert über Themen, die oft verdrängt werden.
Kritik & Protest – Es kann ein Werkzeug sein, um politische oder gesellschaftliche Ungerechtigkeiten anzuprangern.
Empathie & Identifikation – Durch echte Geschichten fühlen sich Zuschauer:innen stärker angesprochen.
Erinnerung & Aufarbeitung – Es hilft, historische Ereignisse lebendig zu halten und sie aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Beispiele aus der Theaterpraxis
„Die Ermittlung“ von Peter Weiss (1965)
Ein Theaterstück, das auf den Frankfurter Auschwitz-Prozessen basiert. Es verzichtet auf Dramatisierung und stellt Gerichtsaussagen fast dokumentarisch dar.
Hans Werner Kroesinger – „Stolpersteine Staatstheater“ (2016)
Ein Stück über die Rolle des Staatstheaters Karlsruhe während der NS-Zeit.
Rimini Protokoll – „Weltklimakonferenz“ (2014)
Ein interaktives Theaterstück, das eine Klimakonferenz nachstellt. Die Zuschauer:innen übernehmen selbst Rollen und erleben die politischen Machtverhältnisse hautnah.
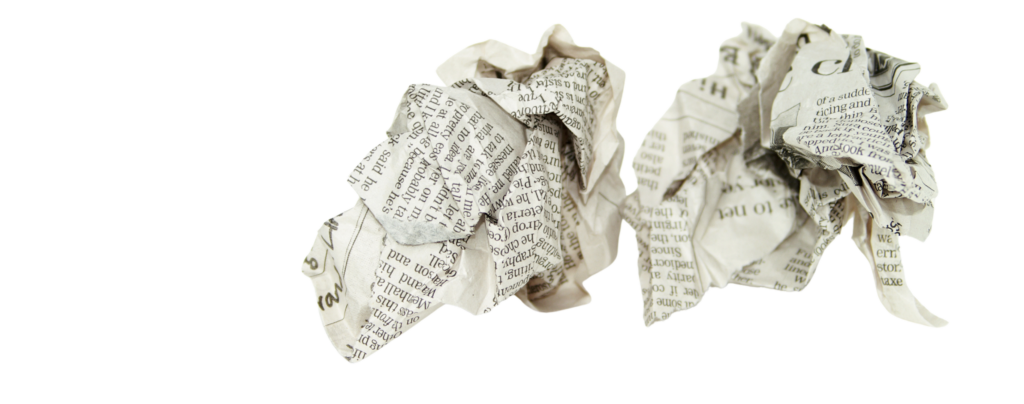
::übungen::

(1) Interview & Monolog – „Erzähl mir deine Geschichte“
Ziel: Ein echtes Interview in eine theatralische Form bringen.
Ablauf:
Sucht euch eine Person (zum Beispiel ein Familienmitglied, eine Lehrkraft oder eine Mitschülerin/einen Mitschüler), die ihr interviewen könnt. Das Thema kann frei gewählt sein, z. B. „Wie war dein erster Schultag?“ oder „Was bedeutet Heimat für dich?“
Stellt offene Fragen und lasst die Person möglichst frei erzählen. Achtet auf spannende Formulierungen oder besondere Emotionen.
Wählt anschließend eine prägnante Passage aus dem Interview aus und formt daraus einen kurzen Monolog (1–2 Minuten).
Tragt den Monolog auf der Bühne vor – entweder so, wie die Person ihn erzählt hat, oder mit einer eigenen Interpretation (z. B. mit übertriebener Gestik oder Verfremdung).
Variation:
Ihr könnt verschiedene Interview-Ausschnitte miteinander kombinieren und so mehrere Perspektiven zu einem Thema darstellen.
Versucht, euch so nah wie möglich an die Sprache der interviewten Person zu halten, um Authentizität zu bewahren.
(2) Zeitungstheater – „Von der Schlagzeile zur Szene“
Ziel: Eine Nachricht aus der Zeitung oder dem Internet theatral nachstellen und kritisch hinterfragen.
Ablauf:
Sucht euch eine aktuelle Zeitungsmeldung oder einen Online-Artikel zu einem gesellschaftlichen oder politischen Thema.
Lest den Artikel gemeinsam und analysiert ihn:
- Wer erzählt hier die Geschichte?
- Welche Perspektiven fehlen möglicherweise?
- Gibt es eine versteckte Meinung oder Wertung im Artikel?
Erstellt eine szenische Umsetzung des Artikels. Dabei könnt ihr verschiedene Techniken verwenden, z. B.:
Standbilder: Die Gruppe stellt einzelne Szenen aus der Meldung als eingefrorene Bilder nach.
Doppelte Perspektive: Eine Szene wird erst aus der einen, dann aus einer anderen Sicht gespielt (z. B. aus Sicht des Täters und des Opfers).
Verfremdung: Ein ernster Artikel wird als Nachrichtensendung in übertrieben fröhlichem Ton präsentiert, um Ironie und Kritik herauszustellen.
Führt eure Szene auf und diskutiert anschließend mit dem Publikum: Wie wird die Nachricht durch unsere Darstellung verändert? Welche neuen Blickwinkel entstehen?
Variation:
Nehmt eine alte Nachricht und aktualisiert sie: Wie würde der Artikel heute lauten?
Verwendet Originalzitate aus der Meldung und baut sie in eure Szene ein.
(3) Audio-Dokumentation auf der Bühne – „Stimmen der Vergangenheit“
Ziel: Eine reale Audioaufnahme mit theatralen Mitteln auf die Bühne bringen.
Ablauf:
Sucht euch eine authentische Audioaufnahme – das kann eine politische Rede, ein Zeitzeugenbericht oder ein Interview sein. Alternativ könnt ihr selbst ein Gespräch aufzeichnen.
Eine oder mehrere Personen aus der Gruppe hören sich die Aufnahme an und sprechen die Worte synchron nach (wie ein Live-Dubbing).
Währenddessen können andere Mitspieler:innen das Gesagte körperlich umsetzen, indem sie sich passend dazu bewegen oder kleine Szenen improvisieren.
Variiert die Inszenierungstechniken:
- Die Sprechenden bewegen nur ihre Lippen, während andere ihre Stimmen synchron sprechen.
- Das Audio wird verfremdet (z. B. verzerrt abgespielt), um eine neue Bedeutungsebene zu schaffen.
- Einzelne Wörter oder Sätze werden wiederholt oder herausgegriffen und besonders betont.
Variation:
Stellt die Szene minimalistisch dar (nur Licht und Stimme) oder maximal übertrieben (mit ausdrucksstarken Bewegungen).
Verwendet ein reales, emotionales Interview und versucht, die Gefühle der Sprecher:innen mit Mimik und Körpersprache zu verstärken.
